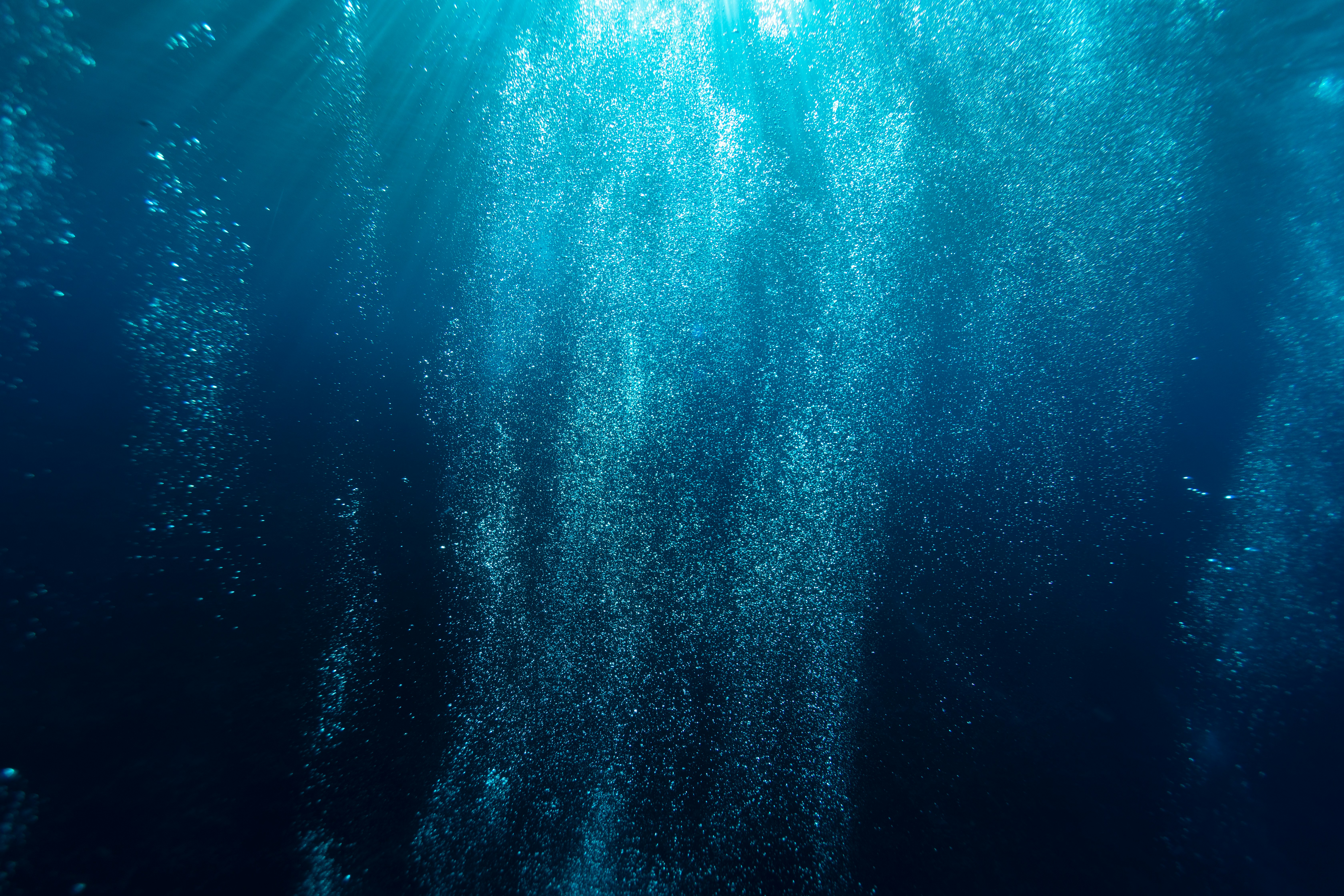
Wie groß ist der Wasserfußabdruck eurer Produktion?
Wie groß ist der Wasserfußabdruck eurer Produktion?
Fragst du dich, was deine Produktion mit den wachsenden Wasserproblemen in Ländern mit einer starken Textilindustrie zu tun hat?
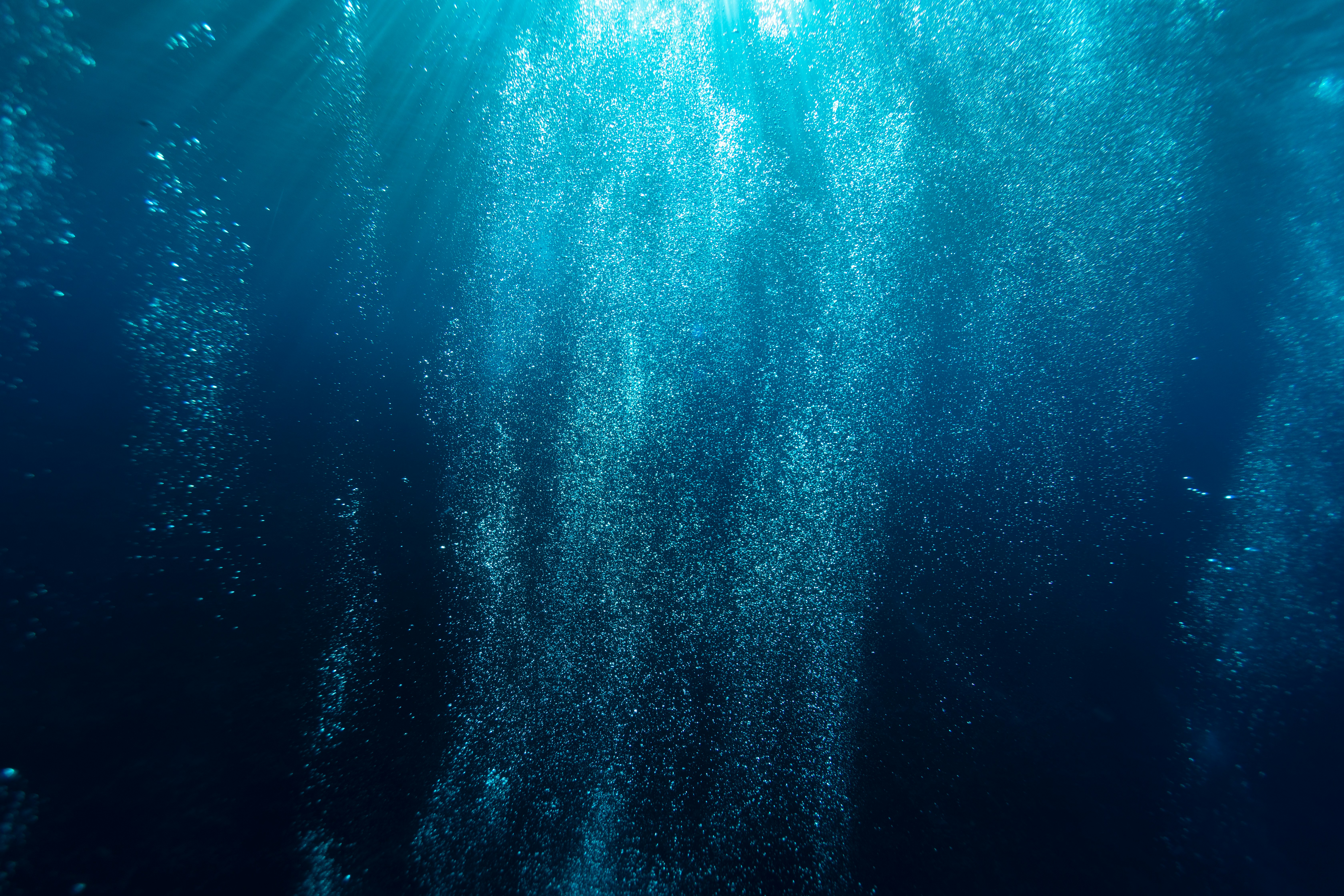
Wie groß ist der Wasserfußabdruck eurer Produktion?
Wie groß ist der Wasserfußabdruck eurer Produktion?
Fragst du dich, was deine Produktion mit den wachsenden Wasserproblemen in Ländern mit einer starken Textilindustrie zu tun hat?
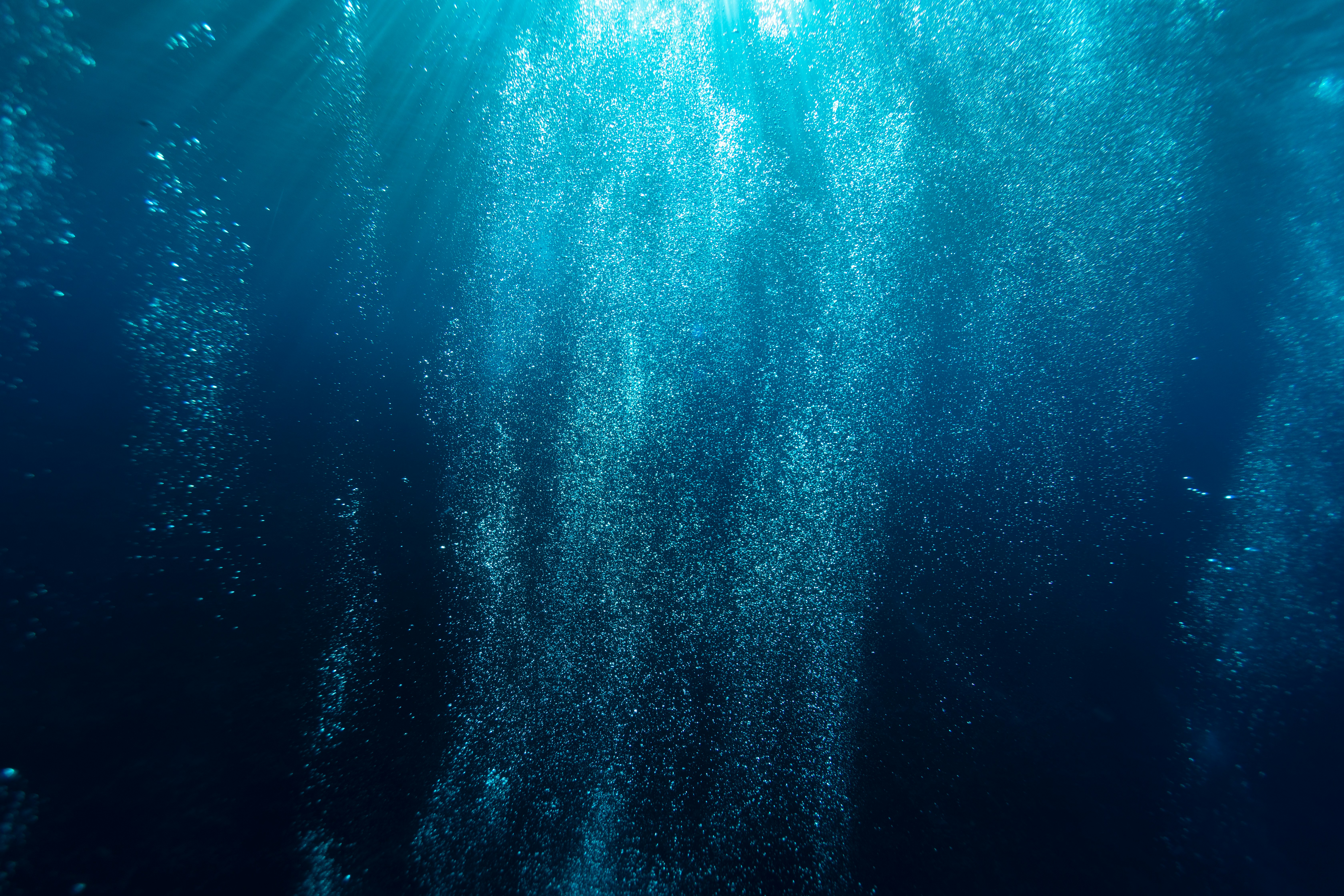
Wie groß ist der Wasserfußabdruck eurer Produktion?
Wie groß ist der Wasserfußabdruck eurer Produktion?
Fragst du dich, was deine Produktion mit den wachsenden Wasserproblemen in Ländern mit einer starken Textilindustrie zu tun hat?
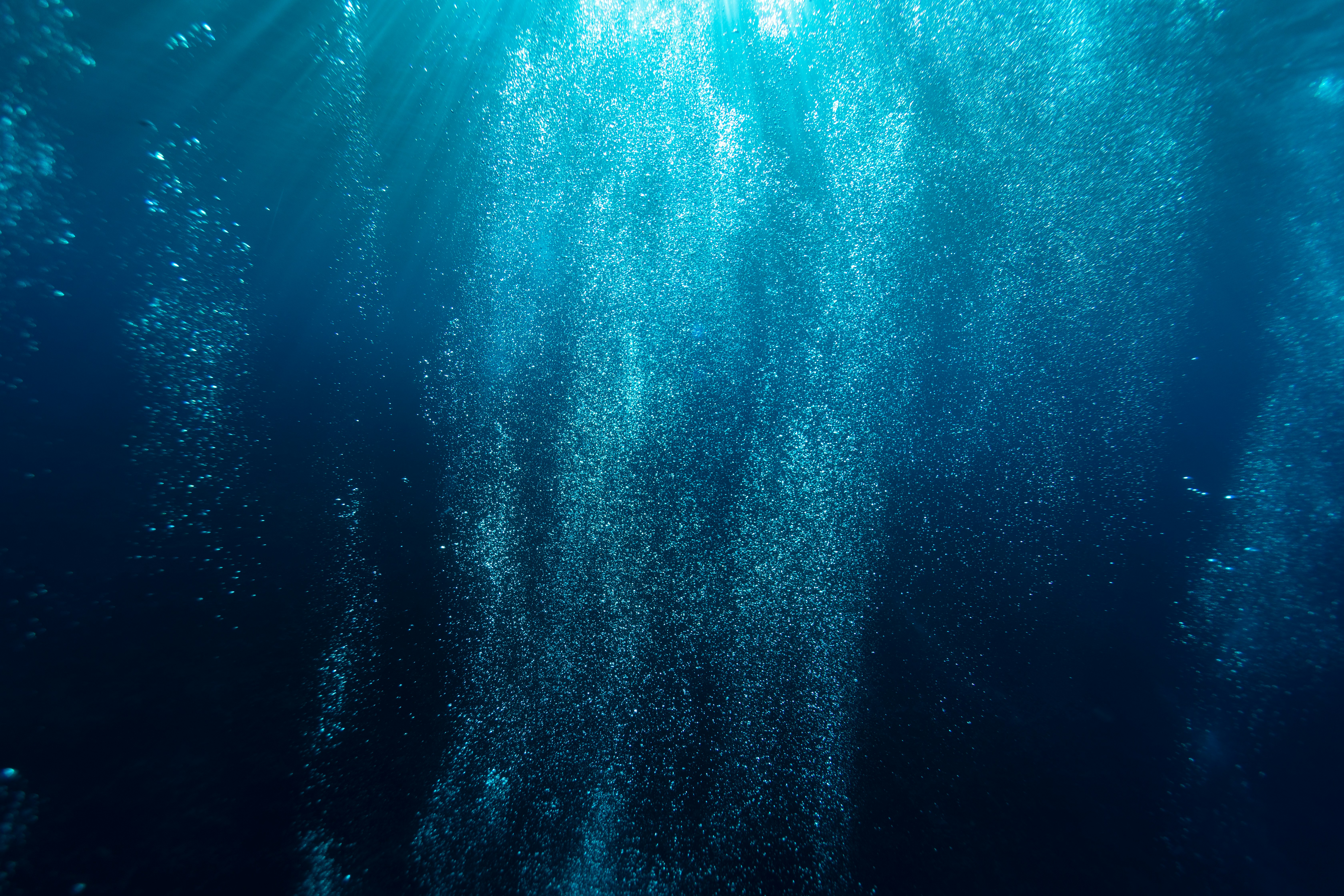
Wie groß ist der Wasserfußabdruck eurer Produktion?
Wie groß ist der Wasserfußabdruck eurer Produktion?
Fragst du dich, was deine Produktion mit den wachsenden Wasserproblemen in Ländern mit einer starken Textilindustrie zu tun hat?
Entdecke die verborgenen Auswirkungen unserer Kleidung und unseres kollektiven Konsums auf die weltweiten Wasserressourcen.
[ 01 ] Der natürliche Wasserkreislauf
Unser Wasser durchläuft unaufhörlich einen zyklischen Prozess. Tatsächlich entsprechen nur 2,5% unserer blauen Ressourcen Süßwasser.
Learn more
[ 02 ] AUS DEM GLEICHGEWICHT
Mit der zunehmenden Kommerzialisierung von Süßwasser als Ressource, die durch den internationalen Handel beeinflusst wird, stehen immer mehr Regionen vor der Herausforderung, ihre (verbleibenden) Wasserressourcen effizient und nachhaltig zu verwalten und zu schützen.
Learn more
[ 03 ] Virtuelles Wasser
Wasser ist nicht nur für den persönlichen Trinkwasserbedarf notwendig, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in der Produktion von Waren und Dienstleistungen.
Learn more
Der Lebenszyklus eines Kleidungsstück
Um Wasserrisiken effektiv zu begegnen, ist es entscheidend zu verstehen, wann, wo und wie sie entstehen. Erfahre mehr über den textilen Lebenszyklus und dessen häufigsten Auswirkungen auf unsere globalen Wasserressourcen.
[ 01 ]

Produktentwicklung und Design
Learn more
[ 02 ]

Beschaffung von Rohstoffen
Learn more
[ 05 ]

Färben und Ausrüsten
Learn more
[ 08 ]

Gebrauch
Learn more
[ 07 ]
Vertrieb
Learn more


[ 03 ]
Verarbeitung von Rohstoffen
Learn more
[ 04 ]

Stricken und Weben
Learn more
[ 06 ]

Konfektion
Learn more
[ 09 ]

END OF LIFE
Learn more
[ 10 ]

LOGISTICS
Learn more
Der Wasserfußabdruck
Während Aussagen wie, "Baumwolle hat im weltweiten Durchschnitt einen Wasserfußabdruck von 9.113 Litern/Kg" für uns als Einzelpersonen wertvolle erste Erkenntnisse bieten, sind solche globalen Durchschnittswerte gefährlich für Modelabels. Der Produktions-Kontext ist hier entscheidend, da der Wasserfußabdruck je nach spezifischen Produktionsszenarien variieren kann.
Die Bewertung des Wasserfußabdrucks eines Kleidungsstücks erfordert eine sorgfältige Analyse der Lieferkette, um die Auswirkungen auf die Umwelt, die Biodiversität und die Menschen vor Ort genau zu verstehen. Globale Durchschnittswerte können nicht alle Produktionsszenarien abdecken, und Studien, die sich auf die spezifische Produktion eines Labels beziehen, können unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Learn more
Materialien: Wie die Fasern in unserer Kleidung die Wasserressourcen beeinflussen
Zwar gibt es keine vollkommen nachhaltige Faser, aber die Bewertung der Umweltauswirkungen eines Materials ist der Schlüssel zur Reduzierung der Gesamtauswirkungen eines Produkts. Da die Auswirkungen eines Materials auf das Wasser je nach Herkunft sehr unterschiedlich sein können, ist es entscheidend, dass Unternehmen eine individuelle Analyse für ihre spezifische Lieferkette durchführen.
Zwar gibt es keine vollkommen nachhaltige Faser, aber die Bewertung der Umweltauswirkungen eines Materials ist der Schlüssel zur Reduzierung der Gesamtauswirkungen eines Produkts. Da die Auswirkungen eines Materials auf das Wasser je nach Herkunft sehr unterschiedlich sein können, ist es entscheidend, dass Unternehmen eine individuelle Analyse für ihre spezifische Lieferkette durchführen.
Zwar gibt es keine vollkommen nachhaltige Faser, aber die Bewertung der Umweltauswirkungen eines Materials ist der Schlüssel zur Reduzierung der Gesamtauswirkungen eines Produkts. Da die Auswirkungen eines Materials auf das Wasser je nach Herkunft sehr unterschiedlich sein können, ist es entscheidend, dass Unternehmen eine individuelle Analyse für ihre spezifische Lieferkette durchführen.
POLYESTER
Polyester ist die weltweit am häufigsten verwendete Faser und machte im Jahr 2022 etwa 54 % der weltweiten Faserproduktion aus.[1] Der Wasserverbrauch bei der Herstellung von Polyesterfasern ist relativ gering (es wird Dampf und Kühlwasser verwendet), hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Wasserqualität. In einer Studie wurde festgestellt, dass der Wasserfußabdruck von Polyesterfasern je nach Herstellung und gewünschtem Ergebnis (Filament- oder Stapelfaser) zwischen 50.690 und 71.409 Litern pro Kilogramm Faser schwankt.[2] Da es sich bei Polyester um eine Faser auf Erdölbasis handelt, sind über 99 % des Wasserverbrauchs auf die Wasserverschmutzung im Zusammenhang mit der Erdölförderung zurückzuführen.[3] Bei der Erdölförderung fällt sogenanntes “produced water” (produziertes Wasser) an, das verschiedene Schadstoffe enthält. Die Behandlung oder Verdünnung dieses Wassers mit großen Mengen Süßwasser ist notwendig, um zu gewährleisten, dass es wieder in die Umwelt zurückgelassen werden kann. Gängige Praktiken sind hier die Rückleitung in den Boden, die Behandlung des Wassers zur Wiederverwendung oder die Verdunstung.[4] Darüber hinaus ist besorgniserregend, dass Mikroplastik beim Waschen synthetischer Materialien in das Abwasser gelangt: Studien zufolge sind synthetische Textilien für 8 % bis 35 % des gesamten Mikroplastiks verantwortlich, das in unseren Gewässern gefunden werden kann.[5] [6]
REC. POLYESTER
Polyester ist die weltweit am häufigsten verwendete Faser und machte im Jahr 2022 etwa 54 % der globalen Faserproduktion aus.[1] Der Wasserverbrauch bei der Herstellung von Polyesterfasern ist relativ gering (hauptsächlich für Dampf und Kühlwasser), hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Wasserqualität. Da Polyester eine erdölbasierte Faser ist, stammen über 99 % seines Wasser-Fußabdrucks aus der Wasserverschmutzung im Zusammenhang mit der Erdölförderung.[2] Bei der Ölförderung entsteht sogenanntes „produziertes Wasser“, das verschiedene Schadstoffe enthält. Um Umweltschäden zu vermeiden, muss dieses Wasser behandelt oder mit großen Mengen Süßwasser verdünnt werden. Gängige Verfahren sind die Rückinjektion ins Erdreich, die Aufbereitung zur Wiederverwendung oder das Verdampfenlassen.[3] Zudem stellt die Freisetzung von Mikroplastik beim Waschen synthetischer Textilien während der Nutzungsphase eines Kleidungsstücks ein Problem dar. Studien zeigen, dass synthetische Textilien für 8 % bis 35 % der Mikroplastikemissionen in Gewässern verantwortlich sind.[4] [5]
REC. BAUMWOLLE
Das mechanische Recycling von Baumwolle ist eine etablierte industrielle Praxis und bringt Vorteile wie reduzierten Wasserverbrauch und CO2-Emissionen mit sich.[1] Obwohl recycelte Baumwolle derzeit nur 1 % der weltweiten Baumwollproduktion ausmacht, gewinnt sie zunehmend an Bedeutung. Es wird erwartet, dass ihr Anteil in den kommenden Jahren erheblich steigen wird.[2] Mechanische Recyclingverfahren führen jedoch zu einer verminderten Faserqualität, vor allem durch die geringere Faserlänge, was häufig eine Zugabe von “neuer” Baumwolle erforderlich macht. Derzeit enthalten die meisten Kleidungsstücke aus recycelter Baumwolle etwa 15-20 % recycelte Fasern[3]. Recycelte Baumwolle birgt ein großes Potenzial um das Problem von Textilabfällen zu bewältigen, zumal das Baumwollrecycling im Vergleich zu “neuen” Fasern erhebliche Einsparungen bei Wasser und CO2-Emissionen ermöglicht.[4] In Ländern wie Bangladesch beispielsweise fallen jährlich schätzungsweise 330.000 Tonnen reine Baumwollabfälle an, von denen derzeit nur 5-7 % recycelt werden. Chemisches Recycling von Baumwolle zu Cellulosefasern ist zwar möglich, aber noch nicht in industriellem Maßstab verfügbar. Weitere Informationen hierzu im Abschnitt über Viskose und recycelte zellulosehaltige Chemiefasern.
BAUMWOLLE
Baumwolle ist auf Platz zwei der weltweit am häufigsten genutzten Fasern und hat im Jahr 2022 etwa 22 % der weltweiten Faserproduktion ausgemacht.[1] Der Baumwollanbau hat erhebliche Auswirkungen auf Wasserressourcen, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht, was auf die Bewässerung und den Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden und Insektiziden in der Landwirtschaft zurückzuführen ist. Die Entnahme von Grund- oder Oberflächenwasser für die Bewässerung von Baumwolle birgt ein erhebliches Risiko für Wasserknappheit. Eine Alternative ist die Nutzung von Regenwasser. Dies bietet ökologische Vorteile, wie einen verringerten Bedarf künstlicher Bewässerung und der Anpassung an die lokale Witterung. Die Unvorhersehbarkeit von Niederschlägen kann diese Praxis jedoch erschweren und sich negativ auf die Ernteerträge auswirken und Wasserstress verursachen. Dies wird durch die Klimakrise noch weiter verschärft. [2] Wenn das Regenwasser nicht ausreicht, greifen Landwirte auf künstliche Bewässerung zurück. Dies erklärt, warum ein beträchtlicher Teil der weltweiten Baumwollproduktion, etwa 45 %, mittels künstliche Bewässerung, oft ergänzt durch Regenwasser, angepflanzt wird.[3] Der weltweit durchschnittliche Wasserfußabdruck von Baumwolle (blau, grün und grau) wird in der Regel mit 9.113 Litern/kg Baumwollflaum angegeben. [4] Der Wasserfußabdruck von Baumwolle variiert je nach landwirtschaftlichen Praktiken und Regionen erheblich. Dies wird deutlich an den Unterschieden zwischen Ländern wie Uganda, das überwiegend auf Regenwasser angewiesen ist, und China, wo die Bewässerung die wichtigste Methode ist. [4] Biobaumwolle hat zwar möglicherweise geringere Auswirkungen auf die Wasserressourcen, potenzielle Verschmutzungsrisiken bestehen jedoch durch den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden fort. Ein geringerer Wasserfußabdruck allein ist keine Garantie für eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen. Die Bewertung der Nachhaltigkeit von Baumwolle erfordert die Berücksichtigung spezifischer Anbaukontexte und die Bewertung lokaler Auswirkungen und Bedingungen.
VISCOSE
Viskose ist weltweit auf Platz vier der am häufigsten verwendete Faser mit einem Marktanteil von 5 % im Jahr 2022. Sie wird aus Zellulose hergestellt. Diese wird in erster Linie aus Holz gewonnen, kann aber auch aus Materialien wie Baumwolle und Bambus hergestellt werden.[1] Bei der Herstellung wird Holzzellulose in einen sich auflösenden Zellstoff umgewandelt, der entweder zu Filament- oder Stapelfasern für die Textilproduktion versponnen wird. In der Filamentform sind Viskosefasern endlose Stränge, während in der Stapelfaserform die Filamente in kurze, vorbestimmte Längen geschnitten werden, was z.B. für die Mischung von Viskose mit anderen Fasern bevorzugt wird. Für die Herstellung von Viskosefasern sind verschiedene chemische Behandlungen und Waschprozesse erforderlich, für die große Mengen an Wasser benötigt werden.[2] Eine Studie zufolge variiert der Wasserfußabdruck von Viskose in drei verschiedenen Produktionsszenarien zwischen 678 und 30.914 Litern pro Kilogramm Faser. Im Bezug auf Wasser ist bei der Viskoseherstellung die Wasserverschmutzung am relevantesten, vor allem in den Produktionsphasen, die wiederkehrende und kontinuierliche Waschprozesse beinhalten und zu hohen Abwasseremissionen führen.[3] Die Variation der Wasserfußabdrücke kann auf die verschiedenen angewandten industriellen Verfahren zurückgeführt werden - die Art der hergestellten Viskosefaser, ob als Stapelfaser (mit den geringsten Wasserauswirkungen) oder als Filamentgarn aus kontinuierlichem Waschen (mit den höchsten Wasserauswirkungen), beeinflusst die beobachteten Unterschiede der Wasserfußabdrücke. Da bestimmte Prozesse je nach gewünschtem Ergebnis ausgewählt werden, kann es eine Herausforderung sein, den Wasserfußabdruck hier allgemein zu reduzieren.Dennoch können Hersteller die Auswirkungen von Viskose auf das Wasser verbessern, indem sie Einfluss auf angewandte Verfahren, und die Standorte der Verarbeitungsstufen nehmen.[4] Die meisten großen Viskosehersteller setzen bereits fortschrittliche Technologien zur Wassereinsparung ein, z.B. Dampfrückgewinnung und Wasserrecycling-Systeme. Der expandierende Viskosemarkt konzentriert sich jedoch auf Länder wie China, Indien und Indonesien, wo die behördliche Aufsicht begrenzt ist und nur wenige Informationen über die Praktiken in Zellstoff- oder Viskosefaserfabriken vorliegen.[5]
REC. CELLULOSE F.
Cellulosische Chemiefasern sind synthetische Fasern auf Zellulosebasis, wie Viskose, Lyocell und Acetat. Chemische Recyclingverfahren für cellulosische Chemiefasern sind zwar möglich, befinden sich jedoch noch in der Entwicklungsphase und sind noch nicht in industriellem Maßstab verfügbar. Diese Verfahren können potenziell Textilabfälle in Zellulosepulpe umwandeln, einen Rohstoff für neue Fasern.[1] Derzeit werden jedoch weniger als 1 % der cellulosischen Chemiefasern aus recycelten oder alternativen Rohstoffen gewonnen, was lediglich 0,49 % der weltweiten Faserproduktion ausmacht.[2]. Die spezifischen Auswirkungen des chemischen Recyclings von Textilien auf das Wasser sind zur Zeit ungewiss, so dass weitere umfassende Studien und technologische Entwicklungen in diesem Bereich erforderlich sind. Trotz der derzeitigen Ungewissheit dürften recycelte zellulosehaltige Chemiefasern im Vergleich zu “neuen” Fasern eine günstigere Umweltbilanz aufweisen. Das Potenzial von recycelten zellulosehaltigen Chemiefasern wird durch Schätzungen unterstrichen, dass das Recycling von nur 25 % der weltweiten Textilabfälle aus Baumwolle vor und nach dem Verbrauch sowie von 25 % der Textilabfälle auf Zellulosebasis, die derzeitig für die Zellulosefaserproduktion benötigten Holzfasern vollständig ersetzen könnten.[3] Dies unterstreicht sowohl das Potenzial als auch die Notwendigkeit weiterer Forschung und Entwicklung in diesem Gebiet zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele für die Textilindustrie.
WOLLE
Die Wasserrisiken in der Wollproduktion beginnen bei der Viehzucht, wo das meiste Wasser nicht als Trinkwasser, sondern indirekt für das Futtermittel verbraucht wird. Abwässer aus tierischen Abfällen können zusätzlich die Wasserqualität beeinträchtigen und Schadstoffe wie Ammoniak, Stickstoff, Phosphor, Krankheitserreger oder Antibiotika in die Gewässer einbringen.[1] Nach dem Scheren wird die Wolle einem Reinigungsverfahren unterzogen, um Verunreinigungen wie Fett oder Schmutz vor der Weiterverarbeitung zu entfernen. Die Wolle wird in der Regel mit Wasser gewaschen, kann aber auch chemisch behandelt werden, z. B. mit Mottenschutzmitteln.[2] Das größte Umweltproblem bei der Wollwäsche ist das Abwasser, das hochkonzentriertes organisches Material, Reinigungsmittel oder Mikroverunreinigungen aus Tierarzneimitteln enthalten kann, die zum Schutz der Schafe vor externen Parasiten eingesetzt werden. Pestizide werden beim Waschen der Wolle oft nicht vollständig entfernt, was für die nachfolgenden Produktionsschritte problematisch ist, in denen die Pestizide noch im Abwasser enthalten sein können. Darüber hinaus ist die unvollständige Entfernung von Pestiziden in der Abwasserbehandlung ökologisch bedenklich, da diese so bei der Ableitung des Abwassers in die lokalen Gewässer gelangen.[3] Ein holistischer Ansatz ist von entscheidender Bedeutung, um die Umweltbedrohungen während des gesamten Wollproduktionsprozesses zu mindern und sicherzustellen, dass bei der Wollwäsche die besten Praktiken angewandt werden, um die Bedrohung für Umwelt und Wasser zu verringern, indem eine ordnungsgemäße Abwasserbehandlung vor der Einleitung in die Umwelt sichergestellt wird.[4] Gleichzeitig ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie die Umweltauswirkungen in der Tierhaltung, einschließlich des Einsatzes von Pestiziden bei Schafen, verringert werden können.
REC. WOLLE
Das Recyceln von Wolle hat eine lange Geschichte in der Wiederverwertung alter Wollkleidung und kann eine nachhaltigere Alternative darstellen. Mit einem Anteil von etwa 7 % am globalen Wollmarkt macht recycelte Wolle nur einen kleinen, aber langsam wachsenden Teil der globalen Textilfaserindustrie aus.[1]
LEDER
Die Lederherstellung umfasst eine Reihe von Prozessen, wie z. B. das Einweichen (Rehydrieren und Waschen der Häute), das Äschern, Entkälken, Gerben (um sicherzustellen, dass die Häute nicht mehr fäulnisanfällig sind) oder das Färben (um der Haut die gewünschte Farbe zu geben), bei denen Wasser, Reinigungsmittel, Kalk, Enzyme und verschiedene Chemikalien verwendet werden.[1] Dies führt zu komplexen Abwässern während der gesamten Lederherstellung, wobei pro Tonne verarbeiteter Rohhäute etwa 15-50 m³ Abwasser entstehen und etwa 500 kg Prozesschemikalien hinzugefügt werden. Daher ist das Abwasser eines der größten Umweltprobleme bei der Lederherstellung, wobei zusätzlich die Gefahr einer Verunreinigung des Grundwassers durch versehentliches Verschütten und Auslaufen bestimmter Stoffe besteht.[2] Die weit verbreitete Verwendung von Chrom(III)-Salzen in 80-90 % der Gerbereien weltweit ist zwar von der EU nicht als gefährlich eingestuft, gibt aber aufgrund der möglichen Oxidation von Chrom(III) zu Chrom(VI) Anlass zu großer Sorge.[3] Wenn Chrom(VI) im Trinkwasser vorhanden ist, stellt es ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, wie z. B. ein erhöhtes Krebsrisiko und Schäden an der Leber und den Fortpflanzungsorganen.[4] Da es an Alternativen zur Chromgerbung fehlt, die Leder mit den gleichen Eigenschaften ausstatten, wenden die Gerbereien in Europa besondere Vorsichtsmaßnahmen an, um die Bildung von Chrom(VI) zu verhindern. Dieses Risiko besteht jedoch weiter, wenn diese Vorsichtsmaßnahmen nicht ordnungsgemäß angewandt oder überwacht werden.[5] Die Umweltauswirkungen von Gerbereien, einschließlich Emissionen und Abfallaufkommen, variieren erheblich je nach Art des hergestellten Leders, der Herkunft der Häute und Felle sowie der spezifischen Gerbtechniken. Trotz dieser Unterschiede bleibt das Abwasser ein bedeutendes Problem in der Lederherstellung, da ein erheblicher Teil der Gerbereiaktivitäten mit Wasser verbunden ist.[6] Die Implementierung von “Best Available Techniques” in Gerbereien und der sorgfältige Umgang mit den möglichen Umweltauswirkungen der Lederindustrie sind von entscheidender Bedeutung.
REC. LEDER
Mit etwa 800 000 Tonnen Lederabfällen, die jedes Jahr anfallen, bietet recyceltes Leder eine potentielle Lösung zur Verringerung der Umweltauswirkungen der Lederindustrie. Einige dieser kreislauffähigen Lösungen werden aus wiederverwendetem Leder hergestellt, oder aus Zuschnittresten, es gibt jedoch auch Materialien aus recycelte Lederfasern.[1]
POLYESTER
REC. POLYESTER
REC. BAUMWOLLE
BAUMWOLLE
VISCOSE
REC. CELLULOSE F.
WOLLE
Die Wasserrisiken in der Wollproduktion beginnen bei der Viehzucht, wo das meiste Wasser nicht als Trinkwasser, sondern indirekt für das Futtermittel verbraucht wird. Abwässer aus tierischen Abfällen können zusätzlich die Wasserqualität beeinträchtigen und Schadstoffe wie Ammoniak, Stickstoff, Phosphor, Krankheitserreger oder Antibiotika in die Gewässer einbringen.[1] Nach dem Scheren wird die Wolle einem Reinigungsverfahren unterzogen, um Verunreinigungen wie Fett oder Schmutz vor der Weiterverarbeitung zu entfernen. Die Wolle wird in der Regel mit Wasser gewaschen, kann aber auch chemisch behandelt werden, z. B. mit Mottenschutzmitteln.[2] Das größte Umweltproblem bei der Wollwäsche ist das Abwasser, das hochkonzentriertes organisches Material, Reinigungsmittel oder Mikroverunreinigungen aus Tierarzneimitteln enthalten kann, die zum Schutz der Schafe vor externen Parasiten eingesetzt werden. Pestizide werden beim Waschen der Wolle oft nicht vollständig entfernt, was für die nachfolgenden Produktionsschritte problematisch ist, in denen die Pestizide noch im Abwasser enthalten sein können. Darüber hinaus ist die unvollständige Entfernung von Pestiziden in der Abwasserbehandlung ökologisch bedenklich, da diese so bei der Ableitung des Abwassers in die lokalen Gewässer gelangen.[3] Ein holistischer Ansatz ist von entscheidender Bedeutung, um die Umweltbedrohungen während des gesamten Wollproduktionsprozesses zu mindern und sicherzustellen, dass bei der Wollwäsche die besten Praktiken angewandt werden, um die Bedrohung für Umwelt und Wasser zu verringern, indem eine ordnungsgemäße Abwasserbehandlung vor der Einleitung in die Umwelt sichergestellt wird.[4] Gleichzeitig ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie die Umweltauswirkungen in der Tierhaltung, einschließlich des Einsatzes von Pestiziden bei Schafen, verringert werden können.
REC. WOLLE
Das Recyceln von Wolle hat eine lange Geschichte in der Wiederverwertung alter Wollkleidung und kann eine nachhaltigere Alternative darstellen. Mit einem Anteil von etwa 7 % am globalen Wollmarkt macht recycelte Wolle nur einen kleinen, aber langsam wachsenden Teil der globalen Textilfaserindustrie aus.[1]
LEDER
Die Lederherstellung umfasst eine Reihe von Prozessen, wie z. B. das Einweichen (Rehydrieren und Waschen der Häute), das Äschern, Entkälken, Gerben (um sicherzustellen, dass die Häute nicht mehr fäulnisanfällig sind) oder das Färben (um der Haut die gewünschte Farbe zu geben), bei denen Wasser, Reinigungsmittel, Kalk, Enzyme und verschiedene Chemikalien verwendet werden.[1] Dies führt zu komplexen Abwässern während der gesamten Lederherstellung, wobei pro Tonne verarbeiteter Rohhäute etwa 15-50 m³ Abwasser entstehen und etwa 500 kg Prozesschemikalien hinzugefügt werden. Daher ist das Abwasser eines der größten Umweltprobleme bei der Lederherstellung, wobei zusätzlich die Gefahr einer Verunreinigung des Grundwassers durch versehentliches Verschütten und Auslaufen bestimmter Stoffe besteht.[2] Die weit verbreitete Verwendung von Chrom(III)-Salzen in 80-90 % der Gerbereien weltweit ist zwar von der EU nicht als gefährlich eingestuft, gibt aber aufgrund der möglichen Oxidation von Chrom(III) zu Chrom(VI) Anlass zu großer Sorge.[3] Wenn Chrom(VI) im Trinkwasser vorhanden ist, stellt es ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, wie z. B. ein erhöhtes Krebsrisiko und Schäden an der Leber und den Fortpflanzungsorganen.[4] Da es an Alternativen zur Chromgerbung fehlt, die Leder mit den gleichen Eigenschaften ausstatten, wenden die Gerbereien in Europa besondere Vorsichtsmaßnahmen an, um die Bildung von Chrom(VI) zu verhindern. Dieses Risiko besteht jedoch weiter, wenn diese Vorsichtsmaßnahmen nicht ordnungsgemäß angewandt oder überwacht werden.[5] Die Umweltauswirkungen von Gerbereien, einschließlich Emissionen und Abfallaufkommen, variieren erheblich je nach Art des hergestellten Leders, der Herkunft der Häute und Felle sowie der spezifischen Gerbtechniken. Trotz dieser Unterschiede bleibt das Abwasser ein bedeutendes Problem in der Lederherstellung, da ein erheblicher Teil der Gerbereiaktivitäten mit Wasser verbunden ist.[6] Die Implementierung von “Best Available Techniques” in Gerbereien und der sorgfältige Umgang mit den möglichen Umweltauswirkungen der Lederindustrie sind von entscheidender Bedeutung.
REC. LEDER
Mit etwa 800 000 Tonnen Lederabfällen, die jedes Jahr anfallen, bietet recyceltes Leder eine potentielle Lösung zur Verringerung der Umweltauswirkungen der Lederindustrie. Einige dieser kreislauffähigen Lösungen werden aus wiederverwendetem Leder hergestellt, oder aus Zuschnittresten, es gibt jedoch auch Materialien aus recycelte Lederfasern.[1]
POLYESTER
REC. POLYESTER
REC. BAUMWOLLE
BAUMWOLLE
VISCOSE
REC. CELLULOSE F.
WOLLE
Die Wasserrisiken in der Wollproduktion beginnen bei der Viehzucht, wo das meiste Wasser nicht als Trinkwasser, sondern indirekt für das Futtermittel verbraucht wird. Abwässer aus tierischen Abfällen können zusätzlich die Wasserqualität beeinträchtigen und Schadstoffe wie Ammoniak, Stickstoff, Phosphor, Krankheitserreger oder Antibiotika in die Gewässer einbringen.[1] Nach dem Scheren wird die Wolle einem Reinigungsverfahren unterzogen, um Verunreinigungen wie Fett oder Schmutz vor der Weiterverarbeitung zu entfernen. Die Wolle wird in der Regel mit Wasser gewaschen, kann aber auch chemisch behandelt werden, z. B. mit Mottenschutzmitteln.[2] Das größte Umweltproblem bei der Wollwäsche ist das Abwasser, das hochkonzentriertes organisches Material, Reinigungsmittel oder Mikroverunreinigungen aus Tierarzneimitteln enthalten kann, die zum Schutz der Schafe vor externen Parasiten eingesetzt werden. Pestizide werden beim Waschen der Wolle oft nicht vollständig entfernt, was für die nachfolgenden Produktionsschritte problematisch ist, in denen die Pestizide noch im Abwasser enthalten sein können. Darüber hinaus ist die unvollständige Entfernung von Pestiziden in der Abwasserbehandlung ökologisch bedenklich, da diese so bei der Ableitung des Abwassers in die lokalen Gewässer gelangen.[3] Ein holistischer Ansatz ist von entscheidender Bedeutung, um die Umweltbedrohungen während des gesamten Wollproduktionsprozesses zu mindern und sicherzustellen, dass bei der Wollwäsche die besten Praktiken angewandt werden, um die Bedrohung für Umwelt und Wasser zu verringern, indem eine ordnungsgemäße Abwasserbehandlung vor der Einleitung in die Umwelt sichergestellt wird.[4] Gleichzeitig ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie die Umweltauswirkungen in der Tierhaltung, einschließlich des Einsatzes von Pestiziden bei Schafen, verringert werden können.
REC. WOLLE
Das Recyceln von Wolle hat eine lange Geschichte in der Wiederverwertung alter Wollkleidung und kann eine nachhaltigere Alternative darstellen. Mit einem Anteil von etwa 7 % am globalen Wollmarkt macht recycelte Wolle nur einen kleinen, aber langsam wachsenden Teil der globalen Textilfaserindustrie aus.[1]
LEDER
Die Lederherstellung umfasst eine Reihe von Prozessen, wie z. B. das Einweichen (Rehydrieren und Waschen der Häute), das Äschern, Entkälken, Gerben (um sicherzustellen, dass die Häute nicht mehr fäulnisanfällig sind) oder das Färben (um der Haut die gewünschte Farbe zu geben), bei denen Wasser, Reinigungsmittel, Kalk, Enzyme und verschiedene Chemikalien verwendet werden.[1] Dies führt zu komplexen Abwässern während der gesamten Lederherstellung, wobei pro Tonne verarbeiteter Rohhäute etwa 15-50 m³ Abwasser entstehen und etwa 500 kg Prozesschemikalien hinzugefügt werden. Daher ist das Abwasser eines der größten Umweltprobleme bei der Lederherstellung, wobei zusätzlich die Gefahr einer Verunreinigung des Grundwassers durch versehentliches Verschütten und Auslaufen bestimmter Stoffe besteht.[2] Die weit verbreitete Verwendung von Chrom(III)-Salzen in 80-90 % der Gerbereien weltweit ist zwar von der EU nicht als gefährlich eingestuft, gibt aber aufgrund der möglichen Oxidation von Chrom(III) zu Chrom(VI) Anlass zu großer Sorge.[3] Wenn Chrom(VI) im Trinkwasser vorhanden ist, stellt es ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, wie z. B. ein erhöhtes Krebsrisiko und Schäden an der Leber und den Fortpflanzungsorganen.[4] Da es an Alternativen zur Chromgerbung fehlt, die Leder mit den gleichen Eigenschaften ausstatten, wenden die Gerbereien in Europa besondere Vorsichtsmaßnahmen an, um die Bildung von Chrom(VI) zu verhindern. Dieses Risiko besteht jedoch weiter, wenn diese Vorsichtsmaßnahmen nicht ordnungsgemäß angewandt oder überwacht werden.[5] Die Umweltauswirkungen von Gerbereien, einschließlich Emissionen und Abfallaufkommen, variieren erheblich je nach Art des hergestellten Leders, der Herkunft der Häute und Felle sowie der spezifischen Gerbtechniken. Trotz dieser Unterschiede bleibt das Abwasser ein bedeutendes Problem in der Lederherstellung, da ein erheblicher Teil der Gerbereiaktivitäten mit Wasser verbunden ist.[6] Die Implementierung von “Best Available Techniques” in Gerbereien und der sorgfältige Umgang mit den möglichen Umweltauswirkungen der Lederindustrie sind von entscheidender Bedeutung.
REC. LEDER
Mit etwa 800 000 Tonnen Lederabfällen, die jedes Jahr anfallen, bietet recyceltes Leder eine potentielle Lösung zur Verringerung der Umweltauswirkungen der Lederindustrie. Einige dieser kreislauffähigen Lösungen werden aus wiederverwendetem Leder hergestellt, oder aus Zuschnittresten, es gibt jedoch auch Materialien aus recycelte Lederfasern.[1]
POLYESTER
Polyester ist die weltweit am häufigsten verwendete Faser und machte im Jahr 2022 etwa 54 % der weltweiten Faserproduktion aus.[1] Der Wasserverbrauch bei der Herstellung von Polyesterfasern ist relativ gering (es wird Dampf und Kühlwasser verwendet), hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Wasserqualität. In einer Studie wurde festgestellt, dass der Wasserfußabdruck von Polyesterfasern je nach Herstellung und gewünschtem Ergebnis (Filament- oder Stapelfaser) zwischen 50.690 und 71.409 Litern pro Kilogramm Faser schwankt.[2] Da es sich bei Polyester um eine Faser auf Erdölbasis handelt, sind über 99 % des Wasserverbrauchs auf die Wasserverschmutzung im Zusammenhang mit der Erdölförderung zurückzuführen.[3] Bei der Erdölförderung fällt sogenanntes “produced water” (produziertes Wasser) an, das verschiedene Schadstoffe enthält. Die Behandlung oder Verdünnung dieses Wassers mit großen Mengen Süßwasser ist notwendig, um zu gewährleisten, dass es wieder in die Umwelt zurückgelassen werden kann. Gängige Praktiken sind hier die Rückleitung in den Boden, die Behandlung des Wassers zur Wiederverwendung oder die Verdunstung.[4] Darüber hinaus ist besorgniserregend, dass Mikroplastik beim Waschen synthetischer Materialien in das Abwasser gelangt: Studien zufolge sind synthetische Textilien für 8 % bis 35 % des gesamten Mikroplastiks verantwortlich, das in unseren Gewässern gefunden werden kann.[5] [6]
REC. POLYESTER
Polyester ist die weltweit am häufigsten verwendete Faser und machte im Jahr 2022 etwa 54 % der globalen Faserproduktion aus.[1] Der Wasserverbrauch bei der Herstellung von Polyesterfasern ist relativ gering (hauptsächlich für Dampf und Kühlwasser), hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Wasserqualität. Da Polyester eine erdölbasierte Faser ist, stammen über 99 % seines Wasser-Fußabdrucks aus der Wasserverschmutzung im Zusammenhang mit der Erdölförderung.[2] Bei der Ölförderung entsteht sogenanntes „produziertes Wasser“, das verschiedene Schadstoffe enthält. Um Umweltschäden zu vermeiden, muss dieses Wasser behandelt oder mit großen Mengen Süßwasser verdünnt werden. Gängige Verfahren sind die Rückinjektion ins Erdreich, die Aufbereitung zur Wiederverwendung oder das Verdampfenlassen.[3] Zudem stellt die Freisetzung von Mikroplastik beim Waschen synthetischer Textilien während der Nutzungsphase eines Kleidungsstücks ein Problem dar. Studien zeigen, dass synthetische Textilien für 8 % bis 35 % der Mikroplastikemissionen in Gewässern verantwortlich sind.[4] [5]
REC. BAUMWOLLE
Das mechanische Recycling von Baumwolle ist eine etablierte industrielle Praxis und bringt Vorteile wie reduzierten Wasserverbrauch und CO2-Emissionen mit sich.[1] Obwohl recycelte Baumwolle derzeit nur 1 % der weltweiten Baumwollproduktion ausmacht, gewinnt sie zunehmend an Bedeutung. Es wird erwartet, dass ihr Anteil in den kommenden Jahren erheblich steigen wird.[2] Mechanische Recyclingverfahren führen jedoch zu einer verminderten Faserqualität, vor allem durch die geringere Faserlänge, was häufig eine Zugabe von “neuer” Baumwolle erforderlich macht. Derzeit enthalten die meisten Kleidungsstücke aus recycelter Baumwolle etwa 15-20 % recycelte Fasern[3]. Recycelte Baumwolle birgt ein großes Potenzial um das Problem von Textilabfällen zu bewältigen, zumal das Baumwollrecycling im Vergleich zu “neuen” Fasern erhebliche Einsparungen bei Wasser und CO2-Emissionen ermöglicht.[4] In Ländern wie Bangladesch beispielsweise fallen jährlich schätzungsweise 330.000 Tonnen reine Baumwollabfälle an, von denen derzeit nur 5-7 % recycelt werden. Chemisches Recycling von Baumwolle zu Cellulosefasern ist zwar möglich, aber noch nicht in industriellem Maßstab verfügbar. Weitere Informationen hierzu im Abschnitt über Viskose und recycelte zellulosehaltige Chemiefasern.
BAUMWOLLE
Baumwolle ist auf Platz zwei der weltweit am häufigsten genutzten Fasern und hat im Jahr 2022 etwa 22 % der weltweiten Faserproduktion ausgemacht.[1] Der Baumwollanbau hat erhebliche Auswirkungen auf Wasserressourcen, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht, was auf die Bewässerung und den Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden und Insektiziden in der Landwirtschaft zurückzuführen ist. Die Entnahme von Grund- oder Oberflächenwasser für die Bewässerung von Baumwolle birgt ein erhebliches Risiko für Wasserknappheit. Eine Alternative ist die Nutzung von Regenwasser. Dies bietet ökologische Vorteile, wie einen verringerten Bedarf künstlicher Bewässerung und der Anpassung an die lokale Witterung. Die Unvorhersehbarkeit von Niederschlägen kann diese Praxis jedoch erschweren und sich negativ auf die Ernteerträge auswirken und Wasserstress verursachen. Dies wird durch die Klimakrise noch weiter verschärft. [2] Wenn das Regenwasser nicht ausreicht, greifen Landwirte auf künstliche Bewässerung zurück. Dies erklärt, warum ein beträchtlicher Teil der weltweiten Baumwollproduktion, etwa 45 %, mittels künstliche Bewässerung, oft ergänzt durch Regenwasser, angepflanzt wird.[3] Der weltweit durchschnittliche Wasserfußabdruck von Baumwolle (blau, grün und grau) wird in der Regel mit 9.113 Litern/kg Baumwollflaum angegeben. [4] Der Wasserfußabdruck von Baumwolle variiert je nach landwirtschaftlichen Praktiken und Regionen erheblich. Dies wird deutlich an den Unterschieden zwischen Ländern wie Uganda, das überwiegend auf Regenwasser angewiesen ist, und China, wo die Bewässerung die wichtigste Methode ist. [4] Biobaumwolle hat zwar möglicherweise geringere Auswirkungen auf die Wasserressourcen, potenzielle Verschmutzungsrisiken bestehen jedoch durch den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden fort. Ein geringerer Wasserfußabdruck allein ist keine Garantie für eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen. Die Bewertung der Nachhaltigkeit von Baumwolle erfordert die Berücksichtigung spezifischer Anbaukontexte und die Bewertung lokaler Auswirkungen und Bedingungen.
VISCOSE
Viskose ist weltweit auf Platz vier der am häufigsten verwendete Faser mit einem Marktanteil von 5 % im Jahr 2022. Sie wird aus Zellulose hergestellt. Diese wird in erster Linie aus Holz gewonnen, kann aber auch aus Materialien wie Baumwolle und Bambus hergestellt werden.[1] Bei der Herstellung wird Holzzellulose in einen sich auflösenden Zellstoff umgewandelt, der entweder zu Filament- oder Stapelfasern für die Textilproduktion versponnen wird. In der Filamentform sind Viskosefasern endlose Stränge, während in der Stapelfaserform die Filamente in kurze, vorbestimmte Längen geschnitten werden, was z.B. für die Mischung von Viskose mit anderen Fasern bevorzugt wird. Für die Herstellung von Viskosefasern sind verschiedene chemische Behandlungen und Waschprozesse erforderlich, für die große Mengen an Wasser benötigt werden.[2] Eine Studie zufolge variiert der Wasserfußabdruck von Viskose in drei verschiedenen Produktionsszenarien zwischen 678 und 30.914 Litern pro Kilogramm Faser. Im Bezug auf Wasser ist bei der Viskoseherstellung die Wasserverschmutzung am relevantesten, vor allem in den Produktionsphasen, die wiederkehrende und kontinuierliche Waschprozesse beinhalten und zu hohen Abwasseremissionen führen.[3] Die Variation der Wasserfußabdrücke kann auf die verschiedenen angewandten industriellen Verfahren zurückgeführt werden - die Art der hergestellten Viskosefaser, ob als Stapelfaser (mit den geringsten Wasserauswirkungen) oder als Filamentgarn aus kontinuierlichem Waschen (mit den höchsten Wasserauswirkungen), beeinflusst die beobachteten Unterschiede der Wasserfußabdrücke. Da bestimmte Prozesse je nach gewünschtem Ergebnis ausgewählt werden, kann es eine Herausforderung sein, den Wasserfußabdruck hier allgemein zu reduzieren.Dennoch können Hersteller die Auswirkungen von Viskose auf das Wasser verbessern, indem sie Einfluss auf angewandte Verfahren, und die Standorte der Verarbeitungsstufen nehmen.[4] Die meisten großen Viskosehersteller setzen bereits fortschrittliche Technologien zur Wassereinsparung ein, z.B. Dampfrückgewinnung und Wasserrecycling-Systeme. Der expandierende Viskosemarkt konzentriert sich jedoch auf Länder wie China, Indien und Indonesien, wo die behördliche Aufsicht begrenzt ist und nur wenige Informationen über die Praktiken in Zellstoff- oder Viskosefaserfabriken vorliegen.[5]
REC. CELLULOSE F.
Cellulosische Chemiefasern sind synthetische Fasern auf Zellulosebasis, wie Viskose, Lyocell und Acetat. Chemische Recyclingverfahren für cellulosische Chemiefasern sind zwar möglich, befinden sich jedoch noch in der Entwicklungsphase und sind noch nicht in industriellem Maßstab verfügbar. Diese Verfahren können potenziell Textilabfälle in Zellulosepulpe umwandeln, einen Rohstoff für neue Fasern.[1] Derzeit werden jedoch weniger als 1 % der cellulosischen Chemiefasern aus recycelten oder alternativen Rohstoffen gewonnen, was lediglich 0,49 % der weltweiten Faserproduktion ausmacht.[2]. Die spezifischen Auswirkungen des chemischen Recyclings von Textilien auf das Wasser sind zur Zeit ungewiss, so dass weitere umfassende Studien und technologische Entwicklungen in diesem Bereich erforderlich sind. Trotz der derzeitigen Ungewissheit dürften recycelte zellulosehaltige Chemiefasern im Vergleich zu “neuen” Fasern eine günstigere Umweltbilanz aufweisen. Das Potenzial von recycelten zellulosehaltigen Chemiefasern wird durch Schätzungen unterstrichen, dass das Recycling von nur 25 % der weltweiten Textilabfälle aus Baumwolle vor und nach dem Verbrauch sowie von 25 % der Textilabfälle auf Zellulosebasis, die derzeitig für die Zellulosefaserproduktion benötigten Holzfasern vollständig ersetzen könnten.[3] Dies unterstreicht sowohl das Potenzial als auch die Notwendigkeit weiterer Forschung und Entwicklung in diesem Gebiet zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele für die Textilindustrie.
WOLLE
Die Wasserrisiken in der Wollproduktion beginnen bei der Viehzucht, wo das meiste Wasser nicht als Trinkwasser, sondern indirekt für das Futtermittel verbraucht wird. Abwässer aus tierischen Abfällen können zusätzlich die Wasserqualität beeinträchtigen und Schadstoffe wie Ammoniak, Stickstoff, Phosphor, Krankheitserreger oder Antibiotika in die Gewässer einbringen.[1] Nach dem Scheren wird die Wolle einem Reinigungsverfahren unterzogen, um Verunreinigungen wie Fett oder Schmutz vor der Weiterverarbeitung zu entfernen. Die Wolle wird in der Regel mit Wasser gewaschen, kann aber auch chemisch behandelt werden, z. B. mit Mottenschutzmitteln.[2] Das größte Umweltproblem bei der Wollwäsche ist das Abwasser, das hochkonzentriertes organisches Material, Reinigungsmittel oder Mikroverunreinigungen aus Tierarzneimitteln enthalten kann, die zum Schutz der Schafe vor externen Parasiten eingesetzt werden. Pestizide werden beim Waschen der Wolle oft nicht vollständig entfernt, was für die nachfolgenden Produktionsschritte problematisch ist, in denen die Pestizide noch im Abwasser enthalten sein können. Darüber hinaus ist die unvollständige Entfernung von Pestiziden in der Abwasserbehandlung ökologisch bedenklich, da diese so bei der Ableitung des Abwassers in die lokalen Gewässer gelangen.[3] Ein holistischer Ansatz ist von entscheidender Bedeutung, um die Umweltbedrohungen während des gesamten Wollproduktionsprozesses zu mindern und sicherzustellen, dass bei der Wollwäsche die besten Praktiken angewandt werden, um die Bedrohung für Umwelt und Wasser zu verringern, indem eine ordnungsgemäße Abwasserbehandlung vor der Einleitung in die Umwelt sichergestellt wird.[4] Gleichzeitig ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie die Umweltauswirkungen in der Tierhaltung, einschließlich des Einsatzes von Pestiziden bei Schafen, verringert werden können.
REC. WOLLE
Das Recyceln von Wolle hat eine lange Geschichte in der Wiederverwertung alter Wollkleidung und kann eine nachhaltigere Alternative darstellen. Mit einem Anteil von etwa 7 % am globalen Wollmarkt macht recycelte Wolle nur einen kleinen, aber langsam wachsenden Teil der globalen Textilfaserindustrie aus.[1]
LEDER
Die Lederherstellung umfasst eine Reihe von Prozessen, wie z. B. das Einweichen (Rehydrieren und Waschen der Häute), das Äschern, Entkälken, Gerben (um sicherzustellen, dass die Häute nicht mehr fäulnisanfällig sind) oder das Färben (um der Haut die gewünschte Farbe zu geben), bei denen Wasser, Reinigungsmittel, Kalk, Enzyme und verschiedene Chemikalien verwendet werden.[1] Dies führt zu komplexen Abwässern während der gesamten Lederherstellung, wobei pro Tonne verarbeiteter Rohhäute etwa 15-50 m³ Abwasser entstehen und etwa 500 kg Prozesschemikalien hinzugefügt werden. Daher ist das Abwasser eines der größten Umweltprobleme bei der Lederherstellung, wobei zusätzlich die Gefahr einer Verunreinigung des Grundwassers durch versehentliches Verschütten und Auslaufen bestimmter Stoffe besteht.[2] Die weit verbreitete Verwendung von Chrom(III)-Salzen in 80-90 % der Gerbereien weltweit ist zwar von der EU nicht als gefährlich eingestuft, gibt aber aufgrund der möglichen Oxidation von Chrom(III) zu Chrom(VI) Anlass zu großer Sorge.[3] Wenn Chrom(VI) im Trinkwasser vorhanden ist, stellt es ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, wie z. B. ein erhöhtes Krebsrisiko und Schäden an der Leber und den Fortpflanzungsorganen.[4] Da es an Alternativen zur Chromgerbung fehlt, die Leder mit den gleichen Eigenschaften ausstatten, wenden die Gerbereien in Europa besondere Vorsichtsmaßnahmen an, um die Bildung von Chrom(VI) zu verhindern. Dieses Risiko besteht jedoch weiter, wenn diese Vorsichtsmaßnahmen nicht ordnungsgemäß angewandt oder überwacht werden.[5] Die Umweltauswirkungen von Gerbereien, einschließlich Emissionen und Abfallaufkommen, variieren erheblich je nach Art des hergestellten Leders, der Herkunft der Häute und Felle sowie der spezifischen Gerbtechniken. Trotz dieser Unterschiede bleibt das Abwasser ein bedeutendes Problem in der Lederherstellung, da ein erheblicher Teil der Gerbereiaktivitäten mit Wasser verbunden ist.[6] Die Implementierung von “Best Available Techniques” in Gerbereien und der sorgfältige Umgang mit den möglichen Umweltauswirkungen der Lederindustrie sind von entscheidender Bedeutung.
REC. LEDER
Mit etwa 800 000 Tonnen Lederabfällen, die jedes Jahr anfallen, bietet recyceltes Leder eine potentielle Lösung zur Verringerung der Umweltauswirkungen der Lederindustrie. Einige dieser kreislauffähigen Lösungen werden aus wiederverwendetem Leder hergestellt, oder aus Zuschnittresten, es gibt jedoch auch Materialien aus recycelte Lederfasern.[1]
Entdecke die verborgenen Auswirkungen unserer Kleidung und unseres kollektiven Konsums auf die weltweiten Wasserressourcen.
[ 01 ] Der natürliche Wasserkreislauf
Unser Wasser durchläuft unaufhörlich einen zyklischen Prozess. Tatsächlich entsprechen nur 2,5% unserer blauen Ressourcen Süßwasser.
Learn more
[ 02 ] AUS DEM GLEICHGEWICHT
Mit der zunehmenden Kommerzialisierung von Süßwasser als Ressource, die durch den internationalen Handel beeinflusst wird, stehen immer mehr Regionen vor der Herausforderung, ihre (verbleibenden) Wasserressourcen effizient und nachhaltig zu verwalten und zu schützen.
Learn more
[ 03 ] Virtuelles Wasser
Wasser ist nicht nur für den persönlichen Trinkwasserbedarf notwendig, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in der Produktion von Waren und Dienstleistungen.
Learn more
[ 01 ] Der natürliche Wasserkreislauf
Unser Wasser durchläuft unaufhörlich einen zyklischen Prozess. Tatsächlich entsprechen nur 2,5% unserer blauen Ressourcen Süßwasser.
Learn more
[ 02 ] AUS DEM GLEICHGEWICHT
Mit der zunehmenden Kommerzialisierung von Süßwasser als Ressource, die durch den internationalen Handel beeinflusst wird, stehen immer mehr Regionen vor der Herausforderung, ihre (verbleibenden) Wasserressourcen effizient und nachhaltig zu verwalten und zu schützen.
Learn more
[ 03 ] Virtuelles Wasser
Wasser ist nicht nur für den persönlichen Trinkwasserbedarf notwendig, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in der Produktion von Waren und Dienstleistungen.
Learn more
Entdecke die verborgenen Auswirkungen unserer Kleidung und unseres kollektiven Konsums auf die weltweiten Wasserressourcen.
[ 01 ] Der natürliche Wasserkreislauf
Unser Wasser durchläuft unaufhörlich einen zyklischen Prozess. Tatsächlich entsprechen nur 2,5% unserer blauen Ressourcen Süßwasser.
Learn more
[ 02 ] AUS DEM GLEICHGEWICHT
Mit der zunehmenden Kommerzialisierung von Süßwasser als Ressource, die durch den internationalen Handel beeinflusst wird, stehen immer mehr Regionen vor der Herausforderung, ihre (verbleibenden) Wasserressourcen effizient und nachhaltig zu verwalten und zu schützen.
Learn more
[ 03 ] Virtuelles Wasser
Wasser ist nicht nur für den persönlichen Trinkwasserbedarf notwendig, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in der Produktion von Waren und Dienstleistungen.
Learn more
[ 01 ] Der natürliche Wasserkreislauf
Unser Wasser durchläuft unaufhörlich einen zyklischen Prozess. Tatsächlich entsprechen nur 2,5% unserer blauen Ressourcen Süßwasser.
Learn more
[ 02 ] AUS DEM GLEICHGEWICHT
Mit der zunehmenden Kommerzialisierung von Süßwasser als Ressource, die durch den internationalen Handel beeinflusst wird, stehen immer mehr Regionen vor der Herausforderung, ihre (verbleibenden) Wasserressourcen effizient und nachhaltig zu verwalten und zu schützen.
Learn more
[ 03 ] Virtuelles Wasser
Wasser ist nicht nur für den persönlichen Trinkwasserbedarf notwendig, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in der Produktion von Waren und Dienstleistungen.
Learn more
Der Lebenszyklus eines Kleidungsstück
Um Wasserrisiken effektiv zu begegnen, ist es entscheidend zu verstehen, wann, wo und wie sie entstehen. Erfahre mehr über den textilen Lebenszyklus und dessen häufigsten Auswirkungen auf unsere globalen Wasserressourcen.
[ 01 ]

Produktentwicklung und Design
Learn more
[ 02 ]

Beschaffung von Rohstoffen
Learn more
[ 05 ]

Färben und Ausrüsten
Learn more
[ 08 ]

Gebrauch
Learn more
[ 07 ]
Vertrieb
Learn more


[ 03 ]
Verarbeitung von Rohstoffen
Learn more
[ 04 ]

Stricken und Weben
Learn more
[ 06 ]

Konfektion
Learn more
[ 09 ]

END OF LIFE
Learn more
[ 01 ]

Produktentwicklung und Design
Learn more
[ 02 ]

Beschaffung von Rohstoffen
Learn more
[ 05 ]

Färben und Ausrüsten
Learn more
[ 08 ]

Gebrauch
Learn more
[ 07 ]
Vertrieb
Learn more


[ 03 ]
Verarbeitung von Rohstoffen
Learn more
[ 04 ]

Stricken und Weben
Learn more
[ 06 ]

Konfektion
Learn more
[ 09 ]

END OF LIFE
Learn more
[ 10 ]


LOGISTICS
Learn more
[ 01 ] Der natürliche Wasserkreislauf
Unser Wasser durchläuft unaufhörlich einen zyklischen Prozess. Tatsächlich entsprechen nur 2,5% unserer blauen Ressourcen Süßwasser.
Learn more
[ 02 ] AUS DEM GLEICHGEWICHT
Mit der zunehmenden Kommerzialisierung von Süßwasser als Ressource, die durch den internationalen Handel beeinflusst wird, stehen immer mehr Regionen vor der Herausforderung, ihre (verbleibenden) Wasserressourcen effizient und nachhaltig zu verwalten und zu schützen.
Learn more
[ 03 ] Virtuelles Wasser
Wasser ist nicht nur für den persönlichen Trinkwasserbedarf notwendig, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in der Produktion von Waren und Dienstleistungen.
Learn more
[ 01 ] Der natürliche Wasserkreislauf
Unser Wasser durchläuft unaufhörlich einen zyklischen Prozess. Tatsächlich entsprechen nur 2,5% unserer blauen Ressourcen Süßwasser.
Learn more
[ 02 ] AUS DEM GLEICHGEWICHT
Mit der zunehmenden Kommerzialisierung von Süßwasser als Ressource, die durch den internationalen Handel beeinflusst wird, stehen immer mehr Regionen vor der Herausforderung, ihre (verbleibenden) Wasserressourcen effizient und nachhaltig zu verwalten und zu schützen.
Learn more
[ 03 ] Virtuelles Wasser
Wasser ist nicht nur für den persönlichen Trinkwasserbedarf notwendig, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in der Produktion von Waren und Dienstleistungen.
Learn more
Der Lebenszyklus eines Kleidungsstück
Um Wasserrisiken effektiv zu begegnen, ist es entscheidend zu verstehen, wann, wo und wie sie entstehen. Erfahre mehr über den textilen Lebenszyklus und dessen häufigsten Auswirkungen auf unsere globalen Wasserressourcen.
[01]


Produktentwicklung und Design
Learn more
[02]


Beschaffung von Rohstoffen
Learn more
[03]


Verarbeitung von Rohstoffen
Learn more
[04]


Stricken und Weben
Learn more
[05]


Färben und Ausrüsten
Learn more
[06]


Konfektion
Learn more
[07]


Vertrieb
Learn more
[08]


Gebrauch
Learn more
[09]


END OF LIFE
Learn more
[10]


LOgisTIK
Learn more
Der Lebenszyklus eines Kleidungsstück
Um Wasserrisiken effektiv zu begegnen, ist es entscheidend zu verstehen, wann, wo und wie sie entstehen. Erfahre mehr über den textilen Lebenszyklus und dessen häufigsten Auswirkungen auf unsere globalen Wasserressourcen.
[01]


Produktentwicklung und Design
Learn more
[02]


Beschaffung von Rohstoffen
Learn more
[03]


Verarbeitung von Rohstoffen
Learn more
[04]


Stricken und Weben
Learn more
[05]


Färben und Ausrüsten
Learn more
[06]


Konfektion
Learn more
[07]


Vertrieb
Learn more
[08]


Gebrauch
Learn more
[09]


END OF LIFE
Learn more
[10]


LOgisTIK
Learn more

Diese Website wurde von der NGO Drip by Drip entwickelt und von Daniela Gomes, Ali Azimi & Daniel Ternes gestaltet und umgesetzt.
Finanziert von Engagement Global mit Mitteln des BMZ.
Für Fragen, Feedback, Anfragen kontaktieren Sie bitte Drip by Drip unter mail@dripbydrip.org.

Diese Website wurde von der NGO Drip by Drip entwickelt und von Daniela Gomes, Ali Azimi & Daniel Ternes gestaltet und umgesetzt.
Finanziert von Engagement Global mit Mitteln des BMZ.
Für Fragen, Feedback, Anfragen kontaktieren Sie bitte Drip by Drip unter mail@dripbydrip.org.

Diese Website wurde von der NGO Drip by Drip entwickelt und von Daniela Gomes, Ali Azimi & Daniel Ternes gestaltet und umgesetzt.
Finanziert von Engagement Global mit Mitteln des BMZ.
Für Fragen, Feedback, Anfragen kontaktieren Sie bitte Drip by Drip unter mail@dripbydrip.org.

Diese Website wurde von der NGO Drip by Drip entwickelt und von Daniela Gomes, Ali Azimi & Daniel Ternes gestaltet und umgesetzt.
Finanziert von Engagement Global mit Mitteln des BMZ.
Für Fragen, Feedback, Anfragen kontaktieren Sie bitte Drip by Drip unter mail@dripbydrip.org.